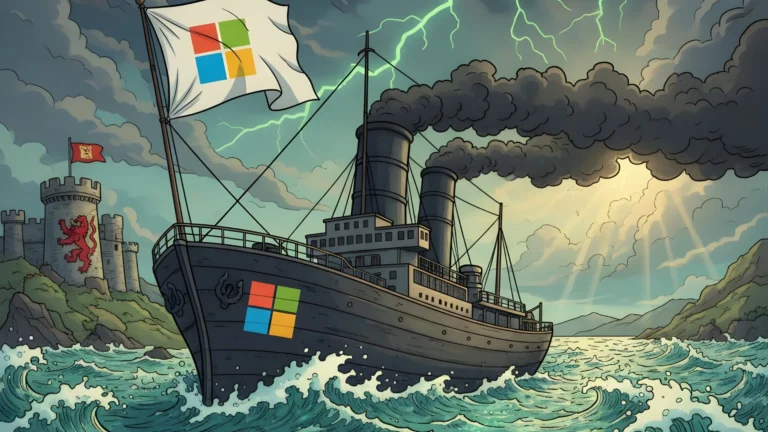Moin und willkommen zum Klönschnack am Sonntag.
Schnapp dir ’nen Kaffee, mach’s dir bequem – und behalt dabei das Hirn eingeschaltet. Könnten wir nämlich brauchen heute, denn es geht um ein Thema, das so alltäglich ist wie Regen an der Küste und trotzdem so verstörend wie ein leerer Hafen an einem Sonntagmorgen.
Die Frage, die heute im Raum steht:
Lässt uns KI das Denken verlernen – und nennen wir das auch noch Fortschritt?
Mike Kuketz, einer der wenigen deutschen Blogger, der noch echte Recherche betreibt, statt ChatGPT-Geschwurbel zu recyceln, hat neulich einen Text rausgehauen, der in der Tech-Community eingeschlagen ist wie ein Torpedo im Maschinenraum. Seine These, grob übersetzt: Wir sind dabei, uns kollektiv das Denken abzutrainieren, bevor wir es richtig gelernt haben. Und das Perfide daran? Wir halten das auch noch für Innovation.
Kuketz erzählt von Studenten, die ChatGPT fragen, wie sie ihre Seminararbeit strukturieren sollen. Von Menschen, die KI um Rat bitten, welche Klamotten zum Wetter passen. Von einer Gesellschaft, die dabei ist, das Zögern, Grübeln und eigenständige Problemlösen an Algorithmen zu delegieren, als wäre es eine lästige Hausarbeit.
Das Fazit ist so scharf wie ein eisiger Nordwind:
Wir verwechseln Bequemlichkeit mit Effizienz und nennen geistige Faulheit Fortschritt.
Die große Entmündigung
Wenn das Smartphone zum Erziehungsberechtigten wird
Aber mal langsam. Ist das wirklich so dramatisch? Immerhin haben auch unsere Großeltern den Niedergang der Zivilisation prophezeit, als die ersten Taschenrechner in die Schulen kamen. „Die Kinder lernen kein Kopfrechnen mehr!“ – und trotzdem haben wir danach noch den Computer, das Internet und sogar Emojis erfunden. Vielleicht ist das hier nur die nächste Iteration des ewigen Kulturpessimismus? Das „früher war alles besser“-Syndrom in neuer, digitaler Verpackung?
Wäre da nur ein Problem: KI ist anders. Ein Taschenrechner rechnet 247 mal 183 aus, mehr nicht. Wikipedia gibt dir Fakten, fertig. Aber ChatGPT, Claude und Co. denken für dich mit. Sie formulieren deine E-Mails, strukturieren deine Gedanken, geben dir Lebensratschläge und entscheiden, welche Argumente in welcher Reihenfolge am überzeugendsten sind. Das ist kein Werkzeug mehr, das ist ein externer Denkapparat.
Kuketz bringt das Problem auf den Punkt: Seine Studenten fragen nicht „Wo finde ich Informationen zu Thema X?“, sondern „Wie soll ich über Thema X denken?“ Das ist der Unterschied zwischen einem Kompass und einem Autopiloten. Der eine zeigt dir die Richtung, der andere steuert das ganze verdammte Schiff.
Der Komfort-Kreislauf: Warum das Gehirn auch nur ein Muskel ist
Die Sache mit der geistigen Bequemlichkeit ist aber komplizierter, als Kuketz sie darstellt. Denn unser Hirn ist von Natur aus faul. Evolutionstechnisch gesehen ist es ein Hochleistungsrechner, der ständig versucht, Energie zu sparen. Warum sich anstrengen, wenn es auch einfacher geht? Warum selbst nachdenken, wenn eine Maschine das schneller und scheinbar fehlerfreier erledigt?
Das Problem ist nur: Denken ist wie Muskeln trainieren. Wer aufhört, verliert die Kraft. Und wer das Denken an KI delegiert, verlernt nicht nur spezifische Fähigkeiten – er verlernt, das Unbehagen des Nichtwissens auszuhalten. Das Gefühl, vor einem Problem zu stehen und sich erst mal den Kopf zerbrechen zu müssen. Dieses produktive Zögern, diese Phase des mentalen Hin-und-Her, in der echte Einsichten entstehen.
Stattdessen konditionieren wir uns auf sofortige Antworten. Auf die Illusion, dass jede Frage eine klare Lösung hat und dass diese Lösung nur einen Prompt entfernt ist. Das ist nicht nur intellektuell gefährlich, das ist auch emotional verheerend. Denn wer nie gelernt hat, mit Unsicherheit umzugehen, wird auch als Erwachsener jede Ambiguität als Bedrohung empfinden.
Die Ironie der Optimierung: Wenn Effizienz zum Selbstzweck wird
Hier steckt ein Paradox, das so typisch für unsere Zeit ist wie schlechte Passwort-Hygiene: Wir optimieren uns zu Tode. Jede menschliche Tätigkeit wird daraufhin abgeklopft, ob sie „effizienter“ gestaltet werden kann. Denken gilt als Zeitverschwendung, wenn die Maschine das schneller hinkriegt. Selbstständiges Problemlösen wird als Nostalgie abgetan.
Aber Effizienz ist nicht dasselbe wie Sinn. Ein Auto ist effizienter als zu Fuß gehen – trotzdem laufen Menschen spazieren, weil der Weg manchmal wichtiger ist als das Ziel. Denken ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch Selbstzweck. Es macht uns zu dem, was wir sind: Menschen, die Probleme nicht nur lösen, sondern dabei auch verstehen, was sie da eigentlich tun.
Kuketz hat recht, wenn er warnt: Wir sind dabei, eine Generation heranzuziehen, die jeden kognitiven Widerstand als Bug betrachtet, der gefixt werden muss. Aber echtes Verstehen entsteht oft gerade durch diesen Widerstand. Durch das mühsame Ringen mit einem Problem, das Ausprobieren verschiedener Ansätze, das Scheitern und Neuanfangen.
Die Kontroverse: Werkzeug oder Krücke?
Die Diskussion um Kuketz‘ Text zeigt, wie gespalten die Tech-Community in dieser Frage ist. Die einen jubeln: „Endlich sagt es mal einer!“ Die anderen kontern: „Übertreibung! KI macht kluge Menschen nur noch klüger.“ Beide Seiten haben einen Punkt – und beide übersehen etwas Wichtiges.
Die KI-Optimisten haben recht, wenn sie sagen, dass Technologie schon immer kognitive Aufgaben übernommen hat. Schrift, Druck, Computer – alles Erfindungen, die das menschliche Gedächtnis und die Rechenleistung erweitert haben. Und ja, es stimmt: KI kann stupide, repetitive Denkarbeit übernehmen und uns für die wirklich wichtigen, kreativen Aufgaben freischaufeln.
Aber die Kritiker haben ebenso recht, wenn sie warnen: Nicht alles, was sich delegieren lässt, sollte auch delegiert werden. Besonders dann nicht, wenn es um die Grundlagen des eigenständigen Denkens geht. Wer nie gelernt hat, eine E-Mail selbst zu formulieren, wird auch keine überzeugenden Argumente entwickeln können. Wer nie geübt hat, Probleme systematisch anzugehen, wird auch komplexere Herausforderungen nicht meistern.
Ein Fazit: Den Kompass nicht aus der Hand geben
Also, was lernen wir daraus? Kuketz liegt richtig – aber nicht vollständig. Die Gefahr ist real, aber sie ist nicht unausweichlich. Es geht nicht darum, KI zu verteufeln oder in die digitale Steinzeit zurückzukehren. Es geht darum, bewusst zu entscheiden, wo wir sie einsetzen und wo wir das Steuer selbst in der Hand behalten.
KI als Werkzeug? Großartig. KI als Denkersatz? Gefährlich. Der Unterschied liegt darin, ob wir sie nutzen, um unsere Fähigkeiten zu erweitern – oder um sie zu ersetzen. Ein Navigationssystem ist hilfreich, aber wer nur noch dem GPS folgt, verlernt, sich selbst zu orientieren. Genauso verhält es sich mit dem Denken.
Die eigentliche Herausforderung ist nicht technischer, sondern kultureller Natur: Wie bewahren wir uns die Bereitschaft zur Anstrengung? Wie schaffen wir es, die Bequemlichkeit der KI zu nutzen, ohne uns dabei die Fähigkeit zur eigenständigen Reflexion abzutrainieren?
Vielleicht ist das die wichtigste Kompetenz unserer Zeit: zu wissen, wann man die Maschine ausschaltet und selbst denkt. Nicht aus Nostalgie oder Technikfeindlichkeit, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass manche Dinge ihren Wert gerade dadurch bekommen, dass sie anstrengend sind.
Und jetzt lass uns darüber diskutieren. Mit dem eigenen Kopf, versteht sich.
Quellmaterial: kuketz-blog.de/